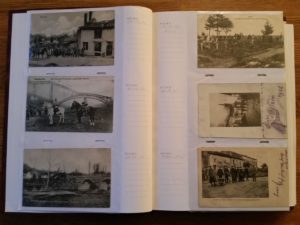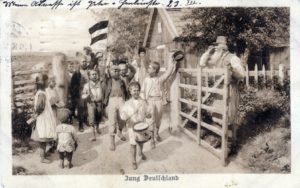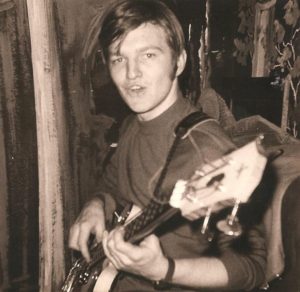In meiner Abizeitschrift war neben dem obligatorischen Steckbrief zu jedem einzelnen Schüler der Stufe auch eine fiese Denunziations- Klatschspalte abgedruckt, in der die Mitschüler anonym etwas über die betreffende Person sagen konnten. Unnötig zu erwähnen, dass unter der Rubrik „Und das sagen Deine Mitschüler über Dich“ bei unbeliebten Schülern schnell unschöne Dinge zusammen kamen, die man seiner Schwiegermuddi in Spe eines Tages lieber nicht zeigen würde.
Unter meinem Grinsefoto stand in besagter Rubrik neben anderen kleineren Gemeinheiten der mysteriöse Satz:
„Siehst Du uns eigentlich?“
Bis heute weiß ich natürlich nicht, wer diese Frage an mich formuliert hat und es ist mir auch von Herzen wurscht. Ich muss aber gestehen, dass ich noch lange nach dem Abi gerätselt habe, was diese Frage denn nun genau zu bedeuten hat.
Mach mal den Test hier!
Unser zehnjähriges Abi-Jubiläum liegt jetzt auch schon wieder ein paar Jahre zurück und die oben zitierte, an mich gerichtete Frage hatte längst aufgehört mir Kopfzerbrechen zu bereiten, als mein Bruder mir eines Tages eine Mail schickte, in der er berichtete, dass er im Netz einen Artikel über Menschen gefunden habe, die außergewöhnliche Fähigkeiten hatten. Und zwar auf dem Gebiet des Gesichter-merkens. Er habe da recherchiert und einen Test des Birbeck Colleges der renommierten University of London gefunden mit dem er seine These, wonach auch er sich sehr gut Gesichter merken könne, nun wissenschaftlich erhärten könne.
Unterschiede
Nun ist es so, dass mein Bruder und ich uns in unserem Sozialverhalten tatsächlich stark voneinander unterscheiden: Während er sehr gut auf Leute zugehen kann und dauernd überall neue Freundschaften knüpft, ist genau das eher nicht so meins. Wenn ich früher auf einer Party niemand kannte, kam ich schwer mit Leuten ins Gespräch. Die Fähigkeit zum Smalltalk habe ich erst nach 10 Monaten Zivildienst im Altenheim erlernt. Wenn Du da mit 90-jährigen Omis nicht lernst übers Wetter zu plaudern, dann schweigst Du halt 10 Monate. Wollte ich nicht, deshalb lernte ich, über meinen Schatten zu springen. Mein Bruder musste sich diese Fähigkeit anscheinend aber nie erarbeiten, er hatte sie einfach.
Gesichter merken fiel mir schon immer schwer
Dass ich mir nicht so gut Gesichter merken oder diese wiedererkennen kann, ist mir schon immer irgendwie bewusst gewesen. Im Gegensatz zu meiner Unfähigkeit mir Namen zu merken, beruht diese Schwäche aber nicht auf Faulheit, sondern auf ehrlichem Unvermögen. Als mein Bruder mir in besagter Mail schrieb, er habe den Test zum Gesichter-erkennen gemacht und dabei 100 Prozent Erfolgsquote gehabt und mich dann auch noch fragte, ob das bei uns in der Familie vielleicht genetisch sei, schwante mir schon, dass wir beide hier wohl unterschiedliche Testergebnisse einfahren würden.
Ich schrieb:
Den Test mach ich später mal und prognostiziere für mich ca. 0 %.
Und fügte noch hinzu: „Ich bin voll gesichtsblind!“ Zwinker-Smiley.
Unterdurchschnittlich

Im Test bekommt man in einem ersten Schritt ein menschliches Gesicht aus drei Perspektiven zu sehen. Es handelt sich um schwarz-weiß Fotos echter Menschen, bei denen nur Kinn, Mund, Nase, Augen, Wangen, Stirn zu sehen sind. Keine Ohren, keine Frisuren. Nachdem man diese drei Perspektiven gesehen hat, werden einem drei weitere Köpfe gezeigt und man muss über die Tastatur die Nummer des Kopfes auswählen, den man zuvor gezeigt bekommen hat.
Bis dahin noch easy und keiner Herausforderung. Danach wird’s aber schwieriger: In einem zweiten Schritt bekommt man für 20 Sekunden 6 der Gesichter zu sehen und muss dann danach aus drei Gesichtern eins auswählen, was man zuvor erkannt hat. Dabei werden aber die Gesichter von drei Seiten gezeigt (links,rechts, vorne).
Spätestens hier war ich auf wildeste Mutmaßung angewiesen und drückte einfach irgendwelche Tasten. Die Testauswertung am Ende war für mich ähnlich verheerend wie Trumps Bilanz als Präsident.
Your accuracy in the experiment was: 60%
The average score on this test is around 80% correct responses for adult participants.
A score of 60% or below may indicate face blindness.
Autsch.
Die sind doch alle uniformiert
Ich begann nachzudenken und zu reflektieren. Am Ergebnis des Tests gab es keinen Zweifel: Beim ZDF Vorabendkrimi neulich hielt es der Regisseur für eine tolle Idee, zwei Hauptrollen mit jungen rothaarigen Frauen zu besetzen. Wer macht denn sowas?!? Ich jedenfalls hatte Probleme, der Handlung zu folgen. War das nicht die Freundin von dem einen Typ da, der…? Ne, doch nicht. War die Andere. Hä?
Erst kürzlich habe ich beruflich einen Vortrag auf einer Management-Tagung gefilmt, bei dem ich im Anschluss noch Stimmen zum Vortrag für eine Umfrage mit der Kamera einzufangen hatte. Dummer Weise war dort direkt nach dem Vortrag Mittagspause, weshalb plötzlich alle Anzugträger wild durcheinander wuselten und ich erhebliche Mühe hatte, mir zu merken, wen von den ganzen Gestalten ich schon nach einem O-Ton gefragt oder sogar schon vor der Kamera hatte. Was müssen die auch alle Business-Tarn von Hugo Boss tragen, ehrlich!
Ich bin gesichtsblind/habe Prosopagnosie

Bevor ihr euch jetzt fragt, ob ich euch beim nächsten Wiedersehen wohl noch erkennen werde: Ja, werde ich. Nein, ich bin nicht dement. Auch wenn ich im Bus oder auf dem Flur mal an euch vorbeirenne, bin ich nicht arrogant – ich erkenne nur nicht immer jeden sofort.
Gesichtsblindheit ist tatsächlich eine Art „Krankheit“ oder besser: eine Schwäche und nennt sich wissenschaftlich Prosopagnosie. Bedeutet aber ganz und gar nicht, dass ich absolut keine Gesichter erkennen kann.
Ich muss mich lediglich mehr anstrengen Personen zu identifizieren. Ein Gesicht ist für mich erst mal kein Wert an sich. Wenn ich Personen unterscheiden will, helfen mir dabei meist Faktoren wie Frisur, Haut- oder Haarfarbe, Kleidung, Statur, Stimme, Mimik oder Gestik. Manchmal sogar Geruch. Aber eher selten.
Wenn also jemand, den ich zum ersten Mal sehe, eine besonders große Nase hat, blond und einen Meter achtzig groß ist, dann erkenne ich ihn problemlos wieder – es sei denn er steht zufälliger Weise genau neben jemandem, der auch eine besonders große Nase hat, blond ist und einen Meter achtzig groß. Dann wirds für mich knifflig.
Für mich persönlich völlig undurchschaubar sind dann Sendungen wie „Germanys Next Topmodel“ oder „Der Bachelor“: Das dort propagierte Schönheitsideal von jungen, symmetrischen, langhaarigen und langbeinigen Supermodel-Frauen macht eine Unterscheidung der Teilnehmer für einen Prosopagnostiker wie mich schon mal ziemlich schwer. Und dann stylen die sich ja auch noch dauernd um, verändern ihren Look – Tarnkappe hoch zehn! Gut, auf der anderen Seite ist von solchen Sendungen ja eh keine anspruchsvolle Handlung voller intellektueller Verflechtungen zu erwarten – da fällt es dann gar nicht auf, da ist es ja eh irgendwie Teil des Konzepts, dass alle Barbies gleich aussehen.
Und wenn wir schon mal beim Thema Intellekt sind: Ganz witzig finde ich übrigens, dass Hochbegabte besonders oft von Prosopagnosie betroffen sein sollen. Behauptet jedenfalls der WDR.
Irreführende Bezeichnung
Das Wort „Gesichtsblindheit“ bzw. die Formulierung „gesichtsblind sein“ ist tatsächlich etwas irreführend: Beides suggeriert, dass man seine Mitmenschen nicht wiedererkennen kann. Dieses generelle Unvermögen haben aber nur Menschen mit einer schweren Hirnschädigung. Sie können Gesichter wirklich nicht erkennen oder verlieren die Fähigkeit zur Gesichtserkennung und -zuordnung.
Das ist bei mir natürlich nicht der Fall. Nimmt man mir aber – wie im Test der Uni London – durch schwarz-weiß Fotos Faktoren wie Augen, oder Hautfarbe weg, nimmt man mir Frisuren und Ohren, dann komme ich bei Gesichtern ins Schwimmen. Dann versuche ich mir zu merken, ob der Mund schmal ist, oder die Wangenknochen ausgeprägt. Ob die Augenbrauen buschig sind oder die Nase breit. Kurz gesagt: Ich entwickele Strategien, um klar zu kommen.
Und deshalb ist mir wie vermutlich vielen Prosopagnostikern bisher nie so recht bewusst gewesen, dass mir etwas fehlt. Da draußen laufen also mit Sicherheit ganz viele „Gesichtsblinde“ wie ich rum, ohne es zu merken. Ein Farbenblinder weiß ja auch nicht von Geburt an, dass er farbenblind ist.
Die Frage des anonymen Mitschülers aus der Abizeitung „Siehst Du uns eigentlich?“ kann ich also jetzt endlich ein für allemal beantworten:
Ja, aber ich muss mir mehr Mühe geben euch zu erkennen – und vielleicht will ich das bei manchem auch einfach gar nicht.