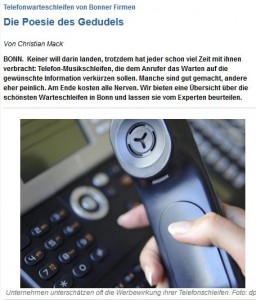Mädchen aus einfachen Verhältnissen heiratet trotz aller Widerstände schmucken Prinzen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute – bis dass der Tod sie scheidet.
Für die meisten von uns sind solche Beziehungsmodelle Märchen. Die Realität meiner Mitmenschen um die 30 sieht völlig anders aus: Wenn’s normal läuft, stolpern wir von Date zu Date, küssen dabei viele glibbrige Frösche oder suchen für unser Minischühchen den passenden Käsefuß und erleben doch kein Happy End. Es sei denn, wir haben unseren Traumprinzen oder die Prinzessin schon gefunden und führen das, was scheinbar immer mehr aus der Mode kommt: Eine langjährige Beziehung.
Mir geht es so: Bald seit 5 Jahren (in Worten fünf) in einer Beziehung, habe ich keine Ahnung mehr vom Singledasein. Für’s Dating-Karussell brauche ich keine Zehnerkarte mehr, muss mir keine Gedanken mehr darüber machen, wie ich dem anderen Geschlecht im Supermarkt begegne, kann mich vielleicht sogar ein kleines bisschen gehen lassen, weil ich ja weiß, dass mich jemand so lieb hat wie ich bin und verspüre nicht den Druck, irgendwo auf dieser Welt „diesen einen Menschen“ noch finden zu müssen.
Trend zwecks mangelnder Bedürftigkeit verpennt

Komfortable Situation. Meine Singlefreunde beneiden mich darum sicher hin und wieder. Ich wiederum habe sie um eine gewisser Erfahrung beneidet: Tinder. Denn immer, wenn mein Singleumfeld im Rudel zusammenkommt, wird über diese eine App gesprochen. Eigentlich wird natürlich über das Singledasein gesprochen, aber seit einiger Zeit scheint diese Daseinsform untrennbar mit dieser ominösen Dating-App verknüpft zu sein. Eigentlich ist diese App, die für meine Singlefreunde das wichtigste Gadget überhaupt zu sein scheint, für mich als „Beziehungstyp“ ja die überflüssigste App überhaupt. Eigentlich.
Trotzdem ich bin ja sowas wie ein Netzbürger. Interessiere mich für Soziale Netzwerke, für Apps, für digitale Trends und als Journalist natürlich auch für alle Formen der Kommunikation. Und als mein Bruder wieder Single wurde und auch anfing über dieses Tinder zu sprechen, wollte ich’s endlich auch wissen.
Tinder – Wie geht das überhaupt?
Vielleicht muss man Tinder aber zuerst noch grob erklären. Vielleicht gibt es ja Menschen in Beziehungen, für die Tinder auch der eigentlich überflüssigste Service der Welt ist. Oder vielleicht liest meine Mutter das hier und fragt sich jetzt, was ihre Söhne da auf den Smartphones haben. Also: Tinder ist laut Eigenwerbung im Google Play Store
„Ein neues Konzept, Leute in deiner Umgebung kennen zu lernen.“
Unter der Hand gilt es bestenfalls als Dating-Service, schlimmstenfalls als Bumms-Börse. Eins ist es aber sicher: Oberflächlich und gleichzeitig unglaublich praktisch, weil effizient.
Wer sich die App auf’s Smartphone lädt (am einfachsten bzw. schnellsten geht das, wenn man schon einen Facebook-Account hat – ohne geht aber auch) kann ein Bild und ein Kurzprofil von sich einstellen, seine Suchpräferenzen eingeben (= lieber Männlein oder Weiblein anzeigen lassen, Altersspanne von-bis und Suchumkreis in Kilometern festlegen) und los geht’s. Über GPS-Ortung (muss immer angeschaltet sein, um den Dienst nutzen zu können), werden einem Profile von Menschen angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen und sich in der Nähe aufhalten. Ein Wisch übers Profil nach links heißt „kein Interesse“, ein Wisch nach rechts bedeutet will-ich-kennen-lernen. Miteinander chatten können zwei Menschen mit deckungsgleichen Suchkriterien erst, wenn sie sich beide mögen, also nach rechts gewischt haben. Das verhindert, dass man von Leuten angelabert wird, an denen man selber kein Interesse hat. Eigentlich ein echter Dating-Fortschritt!

Nun steht bei Tinder wie gesagt nirgendwo offiziell, dass es sich bei der App um ein Dating-Netzwerk handelt. „Leute in der Umgebung kennenlernen“ – dieses harmlose Versprechen habe ich als „Vergebener“ nun also zum Anlass genommen, einen fremden und für mich eigentlich unnötigen Webservice zu erkunden. Sobald die App installiert war, konnte es auch schon los gehen. Da ich mich über mein Facebook-Konto angemeldet hatte, war das Profil auch in Nullkommanix startklar. Also fing ich an, in bester hot-or-not-Manier „Menschen in meiner Umgebung“ zu bewerten. Wer mir äußerlich gefiel und/oder einen irgendwie netten oder interessanten Profiltext hatte bekam mein Wohlwollen. Der Rest wurde aussortiert. Und prompt schrieben mich auch schon die ersten „Menschen aus meiner Umgebung“ an. Das geht ja einfach.
Gar nicht mal so unschuldig
Interessanter Weise waren die natürlich alle weiblich und zwischen 20 und 40 Jahren alt – weil die App dies als Grundeinstellung für mich annahm. Mein naiver Versuch, die App als Leute-Kennenlerndienst und nicht als Dating-Service/Bumms-Börse anzusehen, erlitt Schiffbruch. Das musste ich erkennen, als die Mädels mich anschrieben und auf eine andere Art kennenlernen wollten. Ich hielt es nun für besser, sie über mein Experiment aufzuklären, worauf sie ihr Interesse an mir blitzartig verloren. Bis dahin hatte ich immerhin meinen oberflächlichen Wert auf dem Transfermarkt noch austesten können – das schreib ich mir mal auf die Haben-Seite. Als mich dann aber noch eine Single-Freundin offenbar überrascht bei Facebook anchattete und mich fragte, warum ich denn bei Tinder sei (sie hatte mich da gesehen und weiß, dass ich einer Beziehung bin), wusste ich sicher: 1. Tinder ist keine unschuldige App zum Leute kennenlernen, 2. besagte Single-Freundin versucht ihren Single-Zustand via Tinder zu überwinden.
Ich änderte also meine Strategie, schrieb folgendes in mein Kurzprofil:
Das ist also dieses Tinder da. Vergeben und hier aus rein humanitärem Interesse.
Das Interesse der Damenwelt an mir sank daraufhin rapider als das Niveau im RTL-Dschungel. Auf einen Versuch, neue männliche Kumpels per Tinder kennen zu lernen, habe ich nach dieser Schlappe dann generös verzichtet.
*Über diesen Selbstversuch wurde meine Freundin rechtzeitig informiert. Weder Tiere, noch Gefühle kamen dabei zu Schaden. Paartherapeuten oder Scheidungsanwälte wurden nicht behelligt.